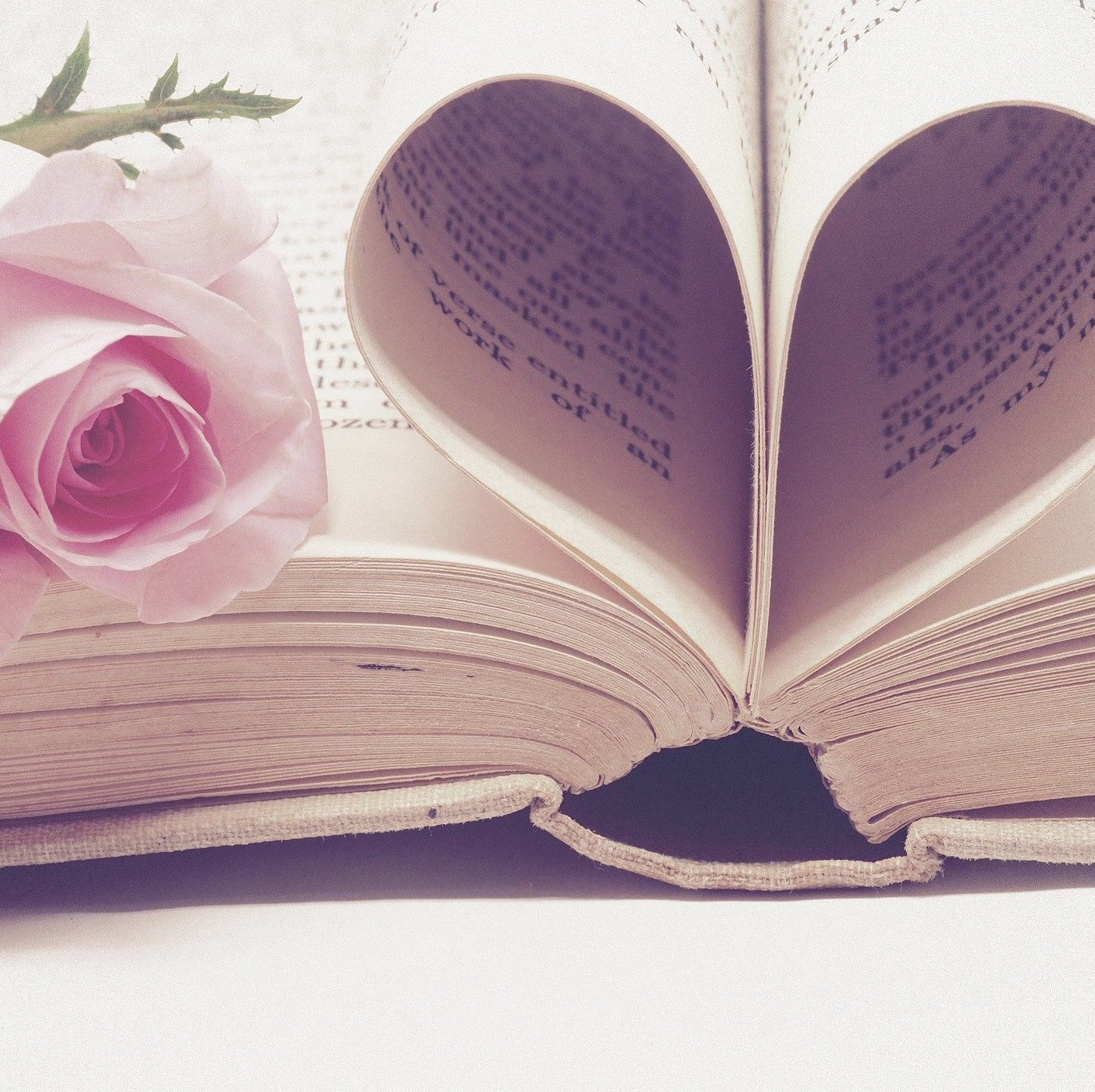Deine Geschichte als Reportage
Eine Reportage ist im Unterschied zum sachlichen Bericht lebendig geschrieben, darf emotional sein, mit Dialogen, szenischen Schilderungen.
Hier eine Leseprobe, ein kleiner Ausschnitt, aus meiner Familiengeschichte, erzählt von meiner Tante, aber in Reportage-Art geschrieben:
Mittwoch, 24. Januar 1945. „Aufstehen die Leute von Guhlau. Es geht weiter“, rief Alfred, der Knecht von Herrn Peukert in die dunkle Gaststube hinein. Ich hatte schon immer einen leichten Schlaf und war sofort hellwach, so rüttelte ich gleich meine Geschwister: „Hanni, Wolfgang, Werner – aufstehen.“ Wolfgang und Werner setzten sich verschlafen auf, nur Hanni bewegte sich nicht. „Hanni – aufstehen, schnell“, ich rüttelte sie nochmal. So klein und schmächtig Hanni auch war, so bockig und stur konnte sie manchmal auch sein. Aber das war es an diesem frühen kalten Mittwochmorgen nicht. Sie war ganz steif und durchgefroren. „Mama, komm schnell“, rief ich. Mama hob die Laterne über Hanni, sah ihre blass-blauen Ärmchen und reagierte blitzschnell. Sie massierte Hannis steife Glieder kräftig durch, rieb und rubbelte die kalten Arme und Beine, pustete immer wieder warme Luft auf Hannis Haut. Ich half sofort mit und knetete und rieb Hannis Beine bis sie Farbe annahmen und Hanni, ganz geschwächt, wieder bei uns war.
Es waren nur sieben Kilometer bis zu unserer nächsten Station Kotzenau – oder Kutzn wie die Einheimischen sagen. Kotzenau liegt versteckt, umgeben von dichtem Wald, ist eine Stadt mit einem richtigen Schloss, gepflasterten Straßen, herrschaftlichen Häusern und der evangelischen Kirche mitten auf dem herrlichen großen Marktplatz. Weil Kutzenau durch Industrie, Handwerk und Handel reich geworden war, hatten die Kutzenauer sogar eine eigene Bahnnebenstrecke bauen lassen, die von Reisicht bis Waltersdorf führte und die Bezirksstadt Liegnitz schneller erreichbar machte.
Wir mussten auf dem Betonboden der Ziegelei übernachten und wieder ging es frühmorgens weiter. Es hieß, der Russe sei ganz dicht hinter uns. Wir hörten schlimme Geschichten vom Brandschatzen, Plündern und Morden und kamen mit unserem Treck gefühlt kaum vorwärts. Wir sollten die Hauptstraßen meiden, fuhren mit unserem Pferdegespann auf holprigen, verschneiten Feldwegen und waren nicht wirklich weit von unserer Heimat Guhlau bei Lüben weg. Zum Hunger kam nun auch noch die Angst.
Mama teilte das Brot ein, dazu gab es Wasser. „Frieda“, flüsterte Frau Hoppe meiner Mutter ins Ohr. „Frieda, ich bitte Dich, hast Du für uns ein Stückchen Brot. Wir haben nichts mitgenommen. Den 2. Tag sind wir schon unterwegs. Wenigstens für meinen Jungen. Frieda, ich bitte Dich.“ Mama wusste, dass wir nicht einmal genug für uns selbst dabeihatten auf dieser Flucht ins Ungewisse, aber sie gab ihr ein Stückchen Brot. Was keiner von uns gemerkt hatte, war, dass unsere Oma ihre Brotration immer der Trudl zusteckte und selbst verzichtete und hungerte….
Weitere Reportagen von mir wurden in diversen Tageszeitungen veröffentlicht und dienen als reine Stilproben. Viel Spaß beim Lesen.
Hier einige allgemeine Textbeispiele für eine Reportage – ungefähre Länge für eine Geschichte
Genieß‘ es heiß!
Am kommenden Sonntag entscheidet Puerto Rico über seine politische Zukunft: teilautonom bleiben oder lieber 51. US-Bundesstaat werden? Urlaubern präsentiert sich die Karibikinsel mal mit Hingabe karibisch, mal typisch amerikanisch.
Wenn Ernest Hemingway einen Abstecher nach Puerto Rico gemacht hätte, dann hätte er sicher Tito kennengelernt, und sein preisgekrönter Roman „Der alte Mann und das Meer“ wäre eine Geschichte zum Schmunzeln geworden. „Eigentlich wollte ich Baseball-Star werden“, erzählt der 71-jährige Fischer. Stattdessen half er seinem Vater mit acht Jahren beim Kanubauen und fuhr mit ihm hinaus aufs Meer. Was heute seine Kinder machen? „Kinder?“, Tito grinst. „Ich bin mir nicht sicher“, charmant täuscht er Verlegenheit vor, „aber soweit ich weiß habe ich nur eines und das ist gerade mal 18 Monate alt.“
Tito ist eigentlich ein typischer Puertoricaner: halb Amerikaner, halb Karibe. Amerikaner? Allerdings! Die Insel im äußersten Osten der Großen Antillen, die mit ihren 9000 Quadratkilometern knapp viermal so groß ist wie das Saarland, war jahrhundertelang unter spanischer Herrschaft. 1898 aber wurde Puerto Rico nach dem Krieg mit den USA amerikanisch. 1917 erhielten die Puertoricaner die US-Bürgerschaft.
Tito ist mit dem American Way of Life groß geworden. Seine Muttersprache ist spanisch, die Landeswährung seit er denken kann der US-Dollar. Als 21-Jähriger erlebte er 1948 die ersten freien Wahlen. Damals wurde die Insel zum teilautonomen Commonwealth-Land im Verbund der USA erklärt.
Seitdem fließen kräftige Subventionen vom Mutterland. Seither blüht die Wirtschaft, und Puerto Rico macht seinem Namen alle Ehre: Es ist ein „reicher Hafen“, der reichste in Lateinamerika! Und das wird wohl auch so blieben – zumindest bis zur Volksabstimmung am kommenden Sonntag. Dann entscheiden die 3,8 Millionen Puertoricaner – wie schon 1967, 1982 und 1993 – wieder einmal darüber, ob der Sonderstatus beibehalten oder ob ihre Insel nun doch zum 51. US-Bundesstaat umgewandelt werden soll. Wohin gehört sie tatsächlich: zur Karibik, zu den USA? Puerto Rico macht einem die Antwort nicht leicht.
Die Puertoricaner sind US-karibisch wie Tito. Mit viel Mimik und Gestik wird amerikanische Service-Flexibilität suggeriert: Niemals gibt es auch nur den Ansatz eines Problems, alles ist immer ok. Allerdings mit der Einschränkung des karibischen „manana“, was so viel heißt wie: „Morgen ist auch noch ein Tag!“
Die Hauptstadt San Juan wirkt ziemlich karibisch. Tag für Tag spucken gigantische Kreuzfahrtschiffe Tausende von Touristen in die Gassen der Altstadt, einer Halbinsel mit dem Hafen im Süden, dem Fort El Morro im äußersten Nordwesten und dem Fort San Cristóbal im Nordosten. Pastellfarbene Häuser leuchten blau, gelb oder rot. Prächtige Fassaden, schneeweiße Kirchen und herrschaftliche Forts erinnern an die Geschichte der Insel.
Auf die Bauten ihres Patenkindes dürften die von historischer Architektur nicht gerade verwöhnten Amerikaner besonders stolz sein. Die Kolonialgeschichte selbst war aber alles andere als ruhmreich. Die Spanier versklavten die Ureinwohner, die Taino-Indianer. Sie kurbelten die Plantagenwirtschaft sowie den Gold- und Silberabbau an. Und rotteten die Tainos aus.
Heute ist Puerto Rico in manchem den USA fast schon zum Verwechseln ähnlich: In den Shopping-Malls, insbesondere dem mit 266 Läden größten Einkaufszentrum der Karibik, der „Plaza de las Americas“ in San Juan, gibt es fast alles, was es auch in den USA gibt. Kitsch und Kult sowie die US-Ketten Macy’s, Banana Republic und Gap.
Freunde nordamerikanischer Kultur müssen auf nichts verzichten, aber sie gewinnen die Karibik dazu: Das hügelige Bergland im Inselinneren ist überzogen von Regenwald. Verschlungene Pfade führen mitten in eine üppig grüne Wunderwelt. Fernes Wasserrauschen lockt tiefer und tiefer hinein. Mit jedem Schritt kommt es näher, bis sich eine Lichtung auftut: Nie war der Sprung ins kalte Wasser so schön wie bei den La Coca-Wasserfällen im El Yunque-Nationalpark.
Wer sich Zeit nimmt für den Dschungel, sieht vielleicht den puertoricanischen Papagei oder das Maskottchen Puerto Ricos, den winzigen Frosch Coqui. Tausenderlei verschiedene Arten kommen ausschließlich in El Yunque vor. „El Yunque ist gut für die Seele“, glaubt Fischer Tito und erzählt von der mysthischen Bedeutung der Bergregion: „In den wolkenverhangenen Gipfeln wohnen die Götter der Tainos.“ Nur ca. 150 Kilometer Luftlinie westlich von El Yunque liegen die phantasieanregenden Camuy-Höhlen. Dieses drittgrößte Höhlensystem der Welt besteht aus kathedralengleichen Grotten, in denen bizarre Stalagtiten herabhängen wie zu Stein gewordene Tränen eines Taino-Berggottes.
Kilometerlange feinsandige Strände gibt es auf Puerto Rico von Palmen gesäumt, am badewannenwarmen Meer. Wenn Tito nach Sonnenuntergang für zwei US-Dollar die letzten Touristen von der vorgelagerten Strandinsel Gilligans abholt und zurück zur Bucht von Guanica übersetzt, laufen wenige Kilometer westlich in La Parguera vollbesetzte Boote aus. Ihr Ziel ist die phosphoreszierende Bucht Bahia Fosforescente. Nur bei Dunkelheit und bewegtem Wasser beginnen unendlich viele Donaflagellaten, winzigste Mikroorganismen, zu leuchten wie ein Sternenhimmel auf Erden. Das Boot zieht einen leuchtenden Schweif hinter sich her wie bei Disney’s Peter Pan-Geschichten.
Zur selben Zeit in San Juan: Die junge Schicki-Micki-Szene erobert die Bürgersteige. Nach klassischer US-Manier lieben sie kleinteilige Elektronik. Zum Inventar des Handtäschchens gehören Organizer, Handy und alles, was sonst noch mit Batterie läuft. Aber das Herz der Jugendlichen schlägt eher im Salsa-Takt. Sie bevölkern die kleinen Bars und neonbeleuchteten Restaurants mit Plastiktischen und knalliger Dekoration. Hier wird echte puertoricanische Küche serviert., wie „Mofongo“, ein Kochbananenpüree je nach Laune mit Gemüse, Fisch, Hummer oder Krabben. Dann wird die ganze Nacht getanzt.
Was ist nun mit Puerto Rico? Ist es hin- und hergerissen zwischen zwei Kulturen wie eine gespaltene Persönlichkeit? Es ist mit Hingabe mal karibisch, mal amerikanisch und dabei 100 Prozent puertoricanisch. Oder wie Tito es ausdrückt: „Du nimmst ein Pfund Amerika und ein Pfund Karibik, mixt alles gut, würzt es mit Salsa, Rum und Regenwald, erhitzt es auf 30 Grad Jahrestemperatur, dann bekommst du Puerto Rico. Genieß‘ es heiß.“
6400 Zeichen mit Leerzeichen.
Segelurlaub beim Klabautermann
Mit einem Oldtimerschiff rund um die dänische Insel Fünen unterwegs – das ist kein alltägliches Segelerlebnis, das ist Gemeinschaftsgefühl.
Morgendunst hängt noch über dem Meer. Drei Schiffe mit weinroten Segeln tauchen plötzlich wie aus dem Nichts auf. Schritte schlurfen über die Holzplanken. Die Masten knarzen leise im Wind. Ein krächzendes Lachen dringt von irgendwoher herüber. Es ist als spürte man den verirrten Geist von Kapitän Blye und seiner „Bounty“ in einem kühlen skandinavischen Windhauch vorüberziehen.
„Leinen los“, ruft Skipper Ole und lässt das Steuerrad rotieren. Der Turbodieselmotor tuckert leise. Jäh erwacht man aus diesem Kindheitstraum vom Leben eines Freibeuters der Meere und ist dennoch mittendrin. Alles ist echt: Die Schiffe, die Schritte, das knarzende Holz und die Schrei der Lachmöwen – Urlaubsalltag auf dem Oldtimer-Segelboot. Unterwegs auf siebentägiger Kreuzfahrt rund um Fünen, der mit 3000 qkm zweitgrößten Insel von Dänemark.
Zusammen mit der Mannschaft aus drei Matrosen und dem Skipper packen Touristen kräftig mit an: ob beim Segelhissen oder Vertäuen, beim Kochen oder Putzen – hier ist sich niemand für irgendeine Arbeit zu schade. Segelkenntnisse sind nicht erforderlich: Skipper Ole macht seine Gäste gleich am ersten Tag am Abfahrtshafen Svendborg mit allen Routineabläufen vertraut. Wer in Svendborg noch Heck und Bug nicht unterscheiden konnte, weiß spätestens am zweiten Morgen in der Bucht von Kerteminde Bescheid.
Sein 28 Meter langer Schoner „Johanne“ ist nur eines von 32 buchbaren traditionellen Holzsegelschiffen, die zwischen Mai und Oktober in der Ostsee kreuzen. In einfachen Kabinen finden höchstens 13 Übernachtungsgäste Platz.
Schon bläst der Wind in die Segel. Die „Johanne“ verlässt die Bucht von Kerteminde und geht auf große Fahrt. Maximal 12 Knoten (rund 22 km/h) erreichen die Holzriesen im ruhigen Gewässer des Großen und Kleinen Belt um Fünen. Schnell genug, um sich den Fahrtwind um die Nase wehen zu lassen, und ausreichend langsam, den Ausblick auf die Landschaften der grünen Inselwelt zu genießen.
Skipper Ole erzählt Geschichten und Legenden rund um die Seefahrt. „Natürlich gibt es einen Klabautermann“, antwortet der blonde bärtige Seewolf fast entrüstet auf die Nachfrage. „Er ist um die 1,40 Meter groß, trägt einen gelben Regenmantel und eine Kapuze. Er steht immer auf der Backbordseite des Schiffes, denn die Steuerbordseite ist den Skippern vorbehalten. Wenn man ihn sieht, muss man ihn sofort über Bord werfen, denn er bringt Unglück.“ Der Tonfall des Kapitäns ist so ernst, dass man ihm beinahe alles glauben möchte, wenn da nicht dieses schalkhafte Zwinkern in den Augen wäre…
Ein Quäntchen Phantasie genügt, um die Holzpantinen zu hören, mit denen einst die Matrosen über Deck schlurften, wenn Skipper Ole von damals erzählt. Von der Zeit, als die „Johanne“ noch Frachtschiff war und Lehmziegel, Holz und Kohle von Insel zu Insel transportierte. Und dass dort drüben auf dem Hügel das Haus des ersten Eigners steht, nach dessen Tochter Johanne der Schoner bei seinem Stapellauf im Jahr 1895 benannt wurde. Je länger man segelt und je mehr man erfährt, desto mehr verliebt man sich in das Boot. Desto mehr versteht man Skipper Ole und alle, die die zeitaufwändige und teure Restaurierung eines solchen Schiffes auf sich nehmen.
Fast surreal wirken jetzt am dritten Tag die modernen Freizeityachten ringsherum. Wie ein Zeitsprung in die Zukunft erscheint die Einfahrt in die kleinen Häfen der Küstenstädte. „Drei Dänen ergeben zwei Vereine“, scherzt Skipper Ole. Und zwei Vereine – so scheint es – unterhalten wiederum je drei Museen. Viele liebevoll zusammengestellte Sammlungen beschäftigen sich mit der Seefahrt und den skurrilen Persönlichkeiten der Insel Fünen: ob das Marine Center am Hafen von Svendborg, das „Haus Ernst“ in Assens oder das Seefahrtmuseum in Faaborg – überall haben ehrenamtliche Mitarbeiter ebenso lebendige wie interessante Details zu den Ausstellungsstücken zu erzählen.
Auf einem Spaziergang durch die Gässchen von Assens oder Faaborg wird klar, warum sich Hans-Christian Andersen, der bekannteste Autor Fünens, den Märchen verschrieben hat: hier locken verwunschene Innenhöfe zum Verweilen, dort duften Rosen vor Zuckerbäckerhäuschen im Fachwerkstil und über allem liegt eine seltsame Ruhe, in der die Seele wie von selbst zu baumeln beginnt.
Spätestens um 23 Uhr hat auch die letzte Kneipe zugesperrt. Dann senkt sich vollkommene Stille über die kleinen Hafenstädte. Der Mondschein streichelt sanft über das Wasser. Vereinzelte Lichter in den Häusern wirken wie ein Spiegelbild des Sternenhimmels. Wenn die Masten leise knarzen und der Wind die Gedanken davonträgt, beginnt wieder die Zeit der Träume – mitten in der Wirklichkeit.
4786 Zeichen mit Leerzeichen
Geschichten aus dem Kafeníon
Auf der griechischen Insel Kreta kehrt im Winter gelassene Ruhe ein
Ein einziges Mal war ich weg von Kreta“, Adonis, der stämmige Mittfünfziger mit dem obligatorisch-griechischen Schnurrbart, hebt gewichtig seinen Zeigefinger: „Da bin ich an der Südküste bei Mirtos fünfzig Meter ins Meer geschwommen.“ Im Kafeníon von Limnis, einem typisch griechischen Kaffeehaus, bricht schallendes Gelächter aus, und Adonis klatscht sich auf die Schenkel. Wie alle anderen 519 999 Einwohner der Insel ist auch er zuerst einmal Kreter und dann erst Grieche – mit dem Herzen am richtigen Fleck. Die Wirtin Kala serviert die nächste Runde hausgebrannten Raki, klaren Tresterschnaps. Dazu gibt es normalerweise immer Kleinigkeiten zu essen wie Oliven, Schafskäse oder Tsatsiki. Weil heute Fremde den Weg in ihr Kafeníon gefunden haben, hat Kala auf die Schnelle Tiropitakia zubereitet, mit Käse gefüllte Blätterteigtaschen.
Im hügeligen Osten Kretas führen viele Straßen zu kleinen ursprünglichen Dörfern wie Limnis. Einem Ort, wo vier Mal am Tag ein Bus durchfährt und noch seltener ein Auto. Wo die Alten vor dem Kafeníon sitzen und die Zeit vorbeistreichen sehen. Wo Olivenbauern mit Säcken voller geernteter Früchte auf ihren Eseln nach Hause reiten. Auf denselben Grautieren, die im Sommer Urlauber über die Eselspfade der Insel tragen.
Von November bis kurz vor Ostern gehören die seltenen Touristen ebenso zum freudig erwarteten Tagesgeschehen wie Yannis, der Mandarinenhändler aus Agios Nikolaos, der quirligen Hafenstadt im Nordosten Kretas. Zweimal wöchentlich hält er mit seinem fahrenden Mandarinenstand vor dem Kafeníon: Er erzählt die neuesten Geschichten aus den Nachbardörfern, gesellt sich zu den anderen und wird erst in etwa einer Stunde weiterziehen. Bis dahin hat er gut 15 Kilo Mandarinen verkauft. Nichts drängt ihn, kein Terminplan scheucht ihn über die Insel. Was er heute nicht schafft, das erledigt er eben morgen.
Im Winter kehrt Ruhe ein auf der fünftgrößten Insel des Mittelmeeres. Die meisten Touristenrestaurants, Souvenirläden und Hotels haben geschlossen. Viele Saisonarbeiter fahren zu ihren Familien auf das griechische Festland oder die anderen Inseln. Und Kreta atmet kräftig durch. Jetzt haben nur noch die urtypischen Tavernen auf. Bei 15 bis 20 Grad grünt und blüht es überall: Hibiskus, Narzissen, Thymian, Oregano und Mandarinen duften um die Wette. 1500 Pflanzenarten gedeihen auf Kreta und mehr als 100 davon wachsen ausschließlich dort.
So still muss es vor mehr als 40 Jahren selbst im Sommer gewesen sein, bevor Kreta als einer der beliebtesten „Plätze an der Sonne“ entdeckt und mit Charterfliegern angesteuert wurde. Jetzt bleibt den ebenso neugierigen wie humorvollen Kretern wieder Zeit für ein Gespräch, einen Raki und einen Kaffee mit ihnen. Wer jetzt kommt – so denken sie -, der will nicht nur Sonne und Strand, sondern der möchte Kreta kennenlernen. Fremde sind wieder Freunde, die man nur noch nicht kennt.
Im Winter wirkt Kreta so gemütlich wie ein großes Kafeníon mit antikem Mobiliar. Denn die 4000 Jahre alte Geschichte der Insel ist überall präsent: ob die minoische Kultur der Königsstadt Knossos, die byzantinischen Kirchen wie die Panagia Kera in Kritsa mit ihren einzigartigen Wandmalereien, venezianische Festungen wie das Fort der vorgelagerten Insel Spinalonga und schlichte orthodoxe Klöster wie jenes im Dorf Areti, in dem nur ein Mönch und eine Nonne leben. Erst die Einsamkeit der Nebensaison lässt die Mystik dieser historischen Stätten hautnah spüren und sie in Gedanken mit dem Leben jener Tage erfüllen.
Um 1900 entdeckte der Brite Sir Arthur Evans die minoische Königsstadt Knossos nahe der Inselhauptstadt Heraklion. Von 2400 bis 1400 vor Christus lebte hier das Volk unter König Minos, einem Sohn von Zeus und Europa. Nur wenig hat man bisher über dieses Volk und ihre Schrift herausfiltern können, unter anderem weil der Entdecker nicht gerade zimperlich mit den Funden umgegangen sein soll. Er schuf die Stätte größtenteils nach seinem Bilde, setzte die Steine zusammen, wie er es für richtig hielt, benannte Häuser und Tempelstätten quer über das Areal und gab ihnen damit ihre Bedeutung. Trotzdem hat sich die von Kritikern als „Disneyland der Archäologie“ bezeichnete antike Stätte nach der Athener Akropolis zur meistbesuchten griechischen Sehenswürdigkeit gemausert.
Ebenso einsam schlendert man durch das Archäologische Museum der Inselhauptstadt, ohne Wartezeiten bewundert man in aller Ruhe die Stalagmiten der Dikti-Höhle in der Hochebene Lassithi, wo der Göttervater Zeus geboren sein soll. Kein Schlangestehen vor der kleinen Panagia Kera-Kirche bei Kritsa mit ihren atemberaubenden Fresken aus dem 13. Jahrhundert.
Wenige Aufseher und Ziegen begleiten die Touristen auf der im Nordosten Kretas vorgelagerten Insel Spinalonga zu ihrer venezianischen Festung. Noch bis 1957 diente die isolierte Burgstadt als Leprastation. Menschenleere Strände zum Beispiel im äußersten Osten bei Vai, laden zum Träumen ein, wo die Gedanken bis zum Horizont und darüber hinaus wandern.
5077 Zeichen mit Leerzeichen